Fast jeder hat die folgende Frage wohl schon einmal so oder in ähnlicher Form gestellt bekommen: „Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welches Jahr würdest du dann zurückreisen?“ Liest man Lindsey Fitzharris‘ Buch Der Horror der frühen Medizin: Joseph Listers Kampf gegen Kurpfuscher, Quacksalber & Knochenklempner, wird in Zukunft die Antwort mit einer an 100 Prozent grenzenden Wahrscheinlichkeit nicht mehr „ins England des frühen neunzehnten Jahrhunderts“ lauten.
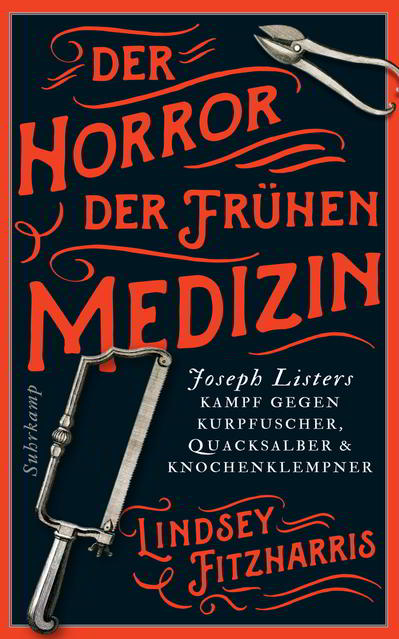
Gegen Anfang des Buchs beschreibt Fitzharris eine der ersten riesigen Hürden, die die Chirurgie nehmen musste, um zu der einigermaßen sicheren Disziplin zu werden, die wir heute kennen. So wurde im Jahr 1864 die erste Operation mit einer erfolgreichen Betäubung des Patienten mit Äther durchgeführt. Davor mussten Operationen weitestgehend bei Bewusstsein durchgestanden werden – die Schmerzen möchte, beziehungsweise kann man man sich wohl gar nicht ausmalen. Chirurgen wurden deshalb unter anderem darauf trainiert, im Operationssaal so schnell wie möglich zu agieren, um das Leid beim Patienten zu minimieren. Beispielsweise brauchte Robert Liston, einer der bekanntesten Operateure Londons, weniger als dreißig Sekunden, um ein Bein zu amputieren.
Vordergründig ist das Buch eine Biografie, denn es beschreibt das Leben des englischen Chirurgen Joseph Lister und dessen Suche nach einem Mittel, um den schrecklichen Zuständen in den Krankenhäusern und der sehr hohen Sterblichkeit bei Operationen – dem nächsten riesigen Hindernis in der Geschichte der Medizin – entgegenzuwirken. Damit verwoben gibt das Buch nicht nur einen Einblick in die Medizingeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, sondern auch in die britische Gesellschaft im viktorianischen England. Diese hochinteressante Mischung macht das Buch unbedingt lesenswert.
Mit seinen 275 Seiten ist Der Horror der frühen Medizin schnell gelesen. Spannend und leicht verständlich geschrieben, wird es zu keiner Stelle wirklich langweilig, obwohl man sich während der einen oder anderen Passage schon wünscht, statt lesen zu müssen, in welches neue Haus Lister gerade einzieht, wieder zum medizingeschichtlichen Teil der Narrative zurückzukehren. Dabei kann man dies dem Buch nicht zu negativ anlasten, schließlich dürfen derartige Informationen in einer Biografie auch nicht fehlen. Ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss: Die Krankheitsbilder und medizinischen Prozeduren, von verfaulten Körperteilen über die Entfernung riesiger Tumore bis hin zur Amputation, werden bis ins Detail beschrieben – am Esstisch sollte das Buch folglich lieber beiseitegelegt werden.
Beim Lesen des Buchs kommt es mitunter außerdem vor, dass man sich ungläubig an den Kopf fasst, wie die Ärzte denn nicht die Verbindung zwischen verdreckten Werkzeugen und entzündeten Wunden herstellen konnten. Spekulativ kann man jedoch sagen, dass die meisten sicherlich überrascht wären, wenn sie wüssten, was die Menschen, die in hundert Jahren (hoffentlich noch) auf der Erde wandeln, rückblickend wohl über unseren wissenschaftlichen Fortschritt und unsere Ignoranz denken werden. Und wer nun doch mit seiner Zeitmaschine ins England des frühen neunzehnten Jahrhunderts reisen möchte, kann sich danach nicht mehr beklagen, nicht ausreichend davor gewarnt worden zu sein.
Dominik Heller (academicworld.net)
Lindsey Fitzharris. Der Horror der Frühen Medizin – Joseph Listers Kampf gegen Kurpfuscher, Quacksalber & Knochenklempner
Suhrkamp Verlag. 14,95€
